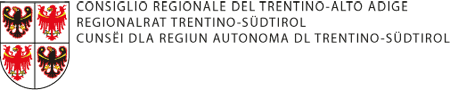Pressemitteilungen
Gesetz zur Erhöhung der Künstlerrente verabschiedet
Am Nachmittag wurde die Debatte zum Begehrensantrag Nr. 2, (Abg. Kaswalder) betreffend „Verbrenner-Aus ab 2035“ wieder aufgenommen: Der Regionalrat fordert das italienische Parlament auf, die Frist für das Ende der Verbrennungsmotorenproduktion über 2035 hinauszuschieben und die CO2-Emissionsziele neu zu verhandeln.
Anna Scarafoni (Fratelli d’Italia) sah die Klimahintergründe für die Überschwemmungen in Oberitalien als Ausdruck einer Ideologie, die an ihrem Ende sei. Dort, wo die Linke an der Regierung sei, seien keine Präventionsmaßnahmen gemacht worden.
Harald Stauder (SVP) bat um Verständnis, dass es zu diesem Thema auch in der Mehrheit unterschiedliche Meinungen gebe. Einige Thesen in diesem Antrag könne man nicht unterstützen. Die SVP habe in den vergangenen Jahren gar einiges in Richtung E-Mobilität auf den Weg gebracht. Seine Fraktion behalte sich vor, nicht für den Antrag zu stimmen.
Michela Calzà (PD) bezeichnete den Klimawandel als Tatsache. Seine Auswirkungen seien evident. Die Überschwemmungen in Oberitalien und anderswo seien immer häufiger geworden, und das sei der Effekt des Klimawandels. Der größte CO2-Ausstoß komme vom Verkehr. Es gehe nun darum, die nötigen Investitionen für den Umstieg vorzunehmen.
Filippo Degasperi (Gemischte Fraktion) bezeichnete Kaswalders Antrag als rückwärtsgewandt und wies ihn darauf hin, dass die Regierung Meloni die bisher größten Beiträge für E-Autos gebe, auch die Provinz Trient gebe Beihilfen.
Präsident Arno Kompatscher verwies auf den Südtiroler Klimaplan, der ehrgeizige Klimaziele setze. Das Land gebe viel Geld für den Umstieg aus, es wäre auch wirtschaftlich verantwortungslos, diese Investitionen in den Wind zu schreiben. Inzwischen hätten auch die europäischen Autohersteller eingesehen, dass man zu lange auf den Verbrenner gesetzt habe. China habe umgerüstet und kaufe keine Verbrenner mehr, das sei der Grund für die Krise in Europa. Auch Wasserstoff werde eine enorme Bedeutung haben, weniger als Antriebskraftstoff denn als Energiespeicher. Er forderte Kaswalder auf, den Antrag zurückzuziehen.
Walter Kaswalder (Patt-Fassa) meinte, dass die europäische Autoindustrie noch nicht bereit für den Umstieg sei, und dem müsse man Rechnung tragen, wenn man nicht Arbeitsplätze riskieren wolle. Er beantragte die Vertagung seines Antrags.
Anschließend wurde über die beiden Tagesordnungsanträge abgestimmt, die zur Debatte über die A22-Konzession eingereicht wurden.
Der Antrag der Mehrheit begrüßt die erfolgte Ausschreibung und fordert die Regionalregierung auf, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Er wurde mit 30 Ja und 29 Enthaltungen angenommen.
Der Antrag der Opposition fordert, sich für den Widerruf der Ausschreibung einzusetzen und wieder auf eine IN-House-Gesellschaft zu setzen. Der Antrag wurde mit 26 Ja, 33 Nein und 2 Enthaltungen abgelehnt.
Gesetzentwurf Nr. 2: Ergänzung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 20. November 2020, Vorsorgemaßnahme für Künstler (eingebracht von den Abg. Oberkofler, Foppa, Rohrer, Coppola, Achammer und Amhof). Mit dem bestehenden Gesetz haben Künstler die Möglichkeit, über die Einzahlung von mindestens 500 Euro in einen Zusatzrentenfonds einen Beitrag von 500 € von der Region als Zusatzrenteneinzahlung zu beziehe. Die Summe des Maximalbeitrages soll nun auf 1.000 € angehoben werden, wobei der Mindestbeitrag bei 500 € liegt. Die Beitragshöhe orientiert sich nach der erfolgten Einzahlung des Beitragsansuchenden in den jeweiligen Zusatzrentenfonds und startet bei einer Einzahlung von minimal 500 €. Die Summe des Beitrages beträgt bei einer Einzahlung zwischen 500 € und 1.000 € gleich viel, wie der eingezahlte Betrag des Beitragsansuchenden. Bei einer Einzahlung über 1.000 € beläuft sich der Beitrag gleichbleibend auf 1.000 €.
Ohne feste Arbeitgeber müssen Künstler selbst für ihre Rentenbeiträge aufkommen, was aufgrund unregelmäßiger Einkommen schwierig ist. Dies führt zu finanziellen Problemen im Alter, erklärte Zeno Oberkofler (Grüne). Die Region habe mit der Künstlerrente dem entgegenwirken wollen, es sei aber noch nicht ausreichend. Daher strebe man nun eine Erhöhung ein.
Philipp Achammer (SVP) erinnerte daran, dass das Gesetz mitten in der Covid-Zeit genehmigt wurde, als die Künstler nicht auftreten konnten. Die Vorsorge sei eine ureigene Aufgabe des Staates, auch in Deutschland, Österreich oder Frankreich gebe es solche Maßnahmen. Künstler lebten buchstäblich von der Hand in den Mund, ihre Gagen seien in den letzten Jahren ziemlich gleichgeblieben. Damit reiche der bestehende Ansatz nicht mehr. Es sei im Grunde ein Beitrag zur Kulturförderung, auch das rechtfertige den Unterschied zu anderen Freiberuflern, die ohne Unterstützung auskommen müssten. Um Missbrauch zu vermeiden, legt das Gesetz Kriterien dafür fest, wer unter die Kategorie Künstler falle. Parallel zum gegenständlichen Gesetzentwurf wolle man auch die Einkommensgrenze erhöhen.
Lucia Coppola (Grüne) unterstrich den Wert der Kulturschaffenden für die Gesellschaft. Die meisten von ihnen würden wenig verdienen. Sie kritisierte, dass das Trentino wenig zur Umsetzung der Maßnahme tue.
Alex Ploner (Team K) kritisierte dies ebenfalls. Die Maßnahme sei ein sehr kleiner Schritt. Wie die Bergbauern seien auch die Künstler zu unterstützen, die Gesellschaft brauche beide. Italien sei das Land der Künstler und Künstlerinnen, lasse sie aber bei der Altersvorsorge allein.
Viele große Künstler seien in Armut gestorben, bemerkte Michela Calzà (PD). Sie forderte die Trentiner Landesregierung auf, schnellstens für die Umsetzung des Gesetzes zu sorgen.
Francesca Gerosa (Fratelli d’Italia) erklärte, dass man bereits begonnen habe, das Künstlerverzeichnis anzulegen. Man müsse die verschiedenen Kunstarten definieren. Jedenfalls werde man die Hürden bald überwinden.
Maria Elisabeth Rieder (Team K) unterstützte das Anliegen, kritisierte aber, dass man unterschiedliche Maßstäbe ansetze, und nannte in diesem Rahmen die Hausfrauenrente. Viele Hausfrauen stünden ohne Altersvorsorge da.
Auch Hannes Rabensteiner (Süd-Tiroler Freiheit) sah hier eine ungleiche Behandlung. Er schätze die Arbeit der Kulturschaffenden. Die meisten würden dies aus Freude machen und nebenher ein schönes Zugeld verdienen. Aber es sei nicht gerecht, wenn man nur für sie das nötige Geld finde und z.B. für die Bergbauern nicht.
Ass. Carlo Daldoss sah die Kunstschaffenden als besondere Arbeiter. Wenn es nur um Arbeit und Lohn gehe, bräuchte man nicht darüber reden, aber hier sei auch Passion im Spiel. Für die Künstlerrente müsse man werben, und die Region werde das ihre tun. Für die Zusatzvorsorge der Bauern gebe es bereits einen Beitrag.
Kunst sei Arbeit, die von der Gesellschaft honoriert werden müsse, erklärte Zeno Oberkofler. Das Gesetz sei ein kleiner, aber guter Schritt. Er warnte davor, Kategorien gegeneinander auszuspielen.
Mit einem Tagesordnungsantrag forderten Franz Ploner und Paul Köllensperger eine umfassende Analyse der bisherigen Umsetzung und die Unterstützung der Provinz Trient bei der vollständigen Implementierung des Gesetzes. Es sollte ermittelt werden, inwieweit die Ziele des Gesetzes erfüllt worden sind, wie die Begünstigten die Wirksamkeit der Maßnahme qualitativ einschätzen und aus welchen Gründen die ursprünglich angedachte Zielgruppe nicht erreicht werden konnte;
Ass. Daldoss plädierte gegen den Antrag, der Aufwand sei nicht gerechtfertigt.
Der Antrag wurde abgelehnt.
Mit einem zweiten Tagesordnungsantrag forderten Alex Ploner und Maria Elisabeth Rieder, zu prüfen, ob die Künstlerrente auch auf die freiberuflichen Publizisten ausgedehnt werden könnte.
Ass. Daldoss gab auch zu diesem Antrag ein negatives Gutachten ab. Publizisten würden nicht unter die Kategorie der Künstler fallen.
Der Antrag wurde abgelehnt.
In der Artikeldebatte forderte Alex Ploner (Team K) mit einem Änderungsantrag einen jährlichen Bericht zur Umsetzung des Gesetzes. Ass. Carlo Daldoss sprach sich dagegen aus, die Daten seien öffentlich. Die Änderung wurde abgelehnt.
Die anderen Artikel wurden ohne Debatte genehmigt.
Der Gesetzentwurf wurde schließlich mit 54 Ja, 1 Nein und 5 Enthaltungen genehmigt.
Gesetzentwurf Nr. 3: Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane - Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 2 vom 3. Mai 2018 (Kodex der örtlichen Körperschaften der autonomen Region Trentino-Südtirol) in geltender Fassung (eingebracht von den Abg. Köllensperger, Rieder, Ploner Alex und Ploner Franz).
Im Wesentlichen geht es um zwei Änderungen, erklärte Paul Köllensperger (Team K): Die Einführung von vier Vorzugsstimmen auch in den Gemeinden der Provinz Trient, wo der Wähler derzeit nur zwei Vorzugsstimmen abgeben kann; die Einführung des Panaschierens bei der Abgabe von Vorzugsstimmen, um die Freiheit bei der Stimmabgabe zu erweitern, d.h. um zu ermöglichen, dass man eine Liste für die Zuteilung der Sitze wählt, aber gleichzeitig auch Kandidaten anderer Listen (jedenfalls bis zu maximal vier) eine Vorzugsstimme gibt. Damit kann man die Vorzugsstimmen von der Listenwahl „entkoppeln“ und verdiente Kandidaten auch anderer Listen wählen. Natürlich steht es den Wählern immer frei, ihre Vorzugsstimmen auch nur Kandidaten derselben Partei oder Liste zuzuweisen oder überhaupt keine Vorzugsstimme abzugeben. Im internationalen Vergleich ist das Panaschieren bei Lokalwahlen vielerorts vorgesehen, wie etwa im Großteil der deutschen Bundesländer (13 von 16), wo es das Panaschieren bei den Gemeindewahlen bereits gibt. In Schweizer Kantonen dürfen insbesondere die Wähler von Kleingemeinden panaschieren, da man dort beinahe jeden Kandidaten einzeln kennt. Ein ähnliches Verfahren ist auch bei französischen Gemeinden mit bis zu 1.000 Einwohnern vorhanden. Auch der Rat der Südtiroler Gemeinden sehe darin interessante Lösungsansätze für die Einsetzung neuer Demokratiemodelle.
Nach Verlesung des Kommissionsberichts durch Mirko Bisesti wurde die Sitzung um 17.25 Uhr geschlossen.
Der Regionalrat tritt im März wieder zusammen.
Videoaufnahmen von der Sitzung:
https://we.tl/t-VftxqwGFAt