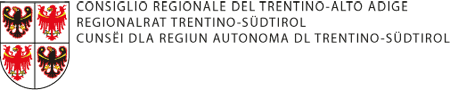Pressemitteilungen
Anhörung zu Wolf und Bär in der 3. Gesetzgebungskommission
Die 3. Gesetzgebungskommission hat heute am Sitz des Regionalrats in Trient eine Anhörung zum Thema „Management von Großraubtieren in der Region“ abgehalten. Hauptziel der Anhörung war es, das Phänomen der Großraubtiere zu untersuchen und geeignete Lösungen für das regionale Gebiet zu entwickeln. Die Präsidentin der Kommission, Eleonora Angeli, betonte „die Bedeutung eines seriösen und unvoreingenommenen Ansatzes“ und wies auf den Zweck der Sitzung hin: die eingehende Analyse unter Beteiligung internationaler Experten, um Lösungen zu finden, die für unser Gebiet funktionieren können.
Am Vormittag sprachen politische Vertreter, darunter die Landesräte des Trentino, Roberto Failoni, und Südtirols, Luis Walcher, Senator Luigi Spagnolli und der Europaabgeordnete Herbert Dorfmann. Auch die Bürgermeister aus beiden Provinzen kamen zu Wort, da eine Delegation von Bürgermeistern aus dem Trentino in den letzten Tagen nach Rom gereist war, um über das Thema zu diskutieren. Landesrat Walcher eröffnete die Anhörung, indem er hauptsächlich über Wölfe sprach: „Wir sind nicht an dem im Trentino gestarteten Projekt Life Ursus beteiligt, in Südtirol haben wir stattdessen negative Erfahrungen mit dem Wolf gemacht. Bis heute haben wir 124 Wölfe im Land, und das Risiko ist vor allem mit den Weiden verbunden, wo es eine hohe Zahl von Übergriffen gibt, 128 allein im letzten Jahr. Wir haben ein Gesetz zur Entnahme von Wölfen in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie, das bei Raubtieren in Schutzgebieten umgesetzt werden sollte. Bislang wurden die beiden beschlossenen Maßnahmen jedoch vom Verwaltungsgericht aufgehoben“.
„Dies ist ein nützlicher Tag für die Zusammenarbeit mit Südtirol“, erklärte der Trentiner Landesrat Failoni, „Sie haben den Wolf, während wir uns auch um das Management des Bären kümmern müssen, dessen Anwesenheit das westliche Trentino betrifft. Wir müssen schnell und konkret handeln, um die Situation in den Griff zu bekommen. Im Jahr 2024 wurden im Trentino drei Problembären entnommen, während es heute - bei insgesamt etwa hundert genetisch überwachten Exemplaren - kein einziges Exemplar gibt, das in diese Kategorie fällt. Die Verwaltung arbeitet unter anderem an der Erneuerung von bärensicheren Mülltonnen, wobei die erste Phase noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll. Dies ist ein Hilfsmittel, keine endgültige Lösung. In einigen Gebieten führt die Anwesenheit der großen Raubtiere zu unsicheren Situationen für die Bewohner, so dass viele es vermeiden, ihre Häuser zu verlassen, sowohl im Wald als auch in den angrenzenden Gebieten. In Bezug auf das Bärenspray (das nach nationalem Recht als Waffe gilt) haben wir eine Antwort auf unsere Anfragen erhalten, die ich für unzureichend halte, da es nur von den Forstbehörden verwendet werden darf. Wir fordern, dass die Einsatzmöglichkeiten zumindest auf den Zivilschutz unter der Leitung der Feuerwehr und die Förster ausgeweitet werden. Wir haben uns auch im Bereich der Kommunikation engagiert, indem wir die Warnschilder durch eine neue Version nach europäischem Vorbild ersetzt und ergänzt haben. Das Projekt Life Ursus, das ich immer abgelehnt habe, sah die Anwesenheit von 40 Bären in dem Gebiet vor. Jetzt sind konkrete Antworten aus Europa gefragt, auch angesichts der Tatsache, dass die Habitat-Richtlinie schon über 30 Jahre alt ist. Es ist nicht länger hinnehmbar, dass Landeshauptmann Fugatti wegen seines Engagements in dieser Frage mit einer Eskorte reisen muss“.
Senator Luigi Spagnolli bemerkte, „dass Maßnahmen gegen große Raubtiere oft von der Verwaltungsgerichtsbarkeit angefochten werden. Aber in Wirklichkeit muss aus Sicherheitsgründen schnell eingegriffen werden. Der Richter entscheidet über das Schutzgut, aber wir müssen unsere Autonomie nutzen, denn Italien ist heterogen und das Problem wird nicht überall gleich gesehen und erlebt. Wir brauchen unsere eigenen Instrumente. Für die Habitat-Richtlinie ist die Tötung des problematischen Tieres dasselbe wie seine Einsperrung in ein Gehege. Hier kommt es auf die Sensibilität der Menschen an.
Den europäischen Ansatz erläuterte der Europaabgeordnete Herbert Dorfmann: „Es gibt heute etwa 25.000 Wölfe in Europa. Die Habitat-Richtlinie von 1992 hat gewirkt, damals war er fast ausgerottet. Im Jahr 2023 wurde der Schutz des Wolfes von der EU-Kommission geändert und herabgestuft. Von streng geschützt, wie in der Berner Konvention festgelegt, wurde eine Herabstufung vorgenommen, die im März dieses Jahres in Kraft treten wird. Es gibt allerdings Einsprüche von Tierschutzverbänden, die diese Regelung angefochten haben. Die Arbeit des Europäischen Parlaments war konkret, es ist nicht wahr, dass es nur Gerede war. Jetzt ist es der italienische Staat, der entscheiden muss, mit der Flexibilität, die die Autonomie erlaubt. Die Situation der Bären ist anders, sie betrifft nicht ganz Europa. Im Trentino ist das Problem ernst, aber es wird keine Herabstufung des Bären geben. In Slowenien gibt es bereits genaue Regeln, die vom Staat vorgesehen sind“.
Abgerundet wurde die Vormittagssitzung durch die Vorträge einer repräsentativen Gruppe von Bürgermeistern: Giacomo Redolfi, Mezzana, Alberto Perli, Andalo, Valerio Linardi, Garniga Terme, und Ivo Bernard, Campitello di Fassa. Auf Südtiroler Seite sprachen Gabriela Kofler, Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix, Felix Ploner Enneberg, Andreas Schatzer, Präsident des Südtiroler Gemeindeverbands der, Robert Alexander Steger, Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertaln und Gustav Tappeiner, Bürgermeister von Kastelbell. Nach der Anhörung der Vertreter der Gemeinden, die ein rasches und entschlossenes Handeln bei einem Problem forderten, das die Bevölkerung sehr stark betrifft, erklärte Präsidentin Angeli die Anhörung am Vormittag für beendet.
Die Sitzung wurde am Nachmittag mit einer Rede von Günther Unterthiner, Leiter des Forstdienstes der Autonomen Provinz Bozen, fortgesetzt: „Seit 2001 wurden in Südtirol genetische Spuren von Bären gefunden, die 70 Jahre lang gefehlt hatten. In 23 Jahren wurden hier 36 Bären gemeldet, alle männlich, außer einem Weibchen. Im Trentino ist die Situation ganz anders, das wissen wir. Wegen der Schäden, die die Tiere hier anrichten, wurden Schutzgebiete ausgewiesen, meist Almen, die besonderen Schutz genießen. Der Wolf wurde 2010 in Südtirol gesichtet: Wir haben kürzlich 124 Tiere identifiziert, aufgeteilt in neun Rudel und sechs Paare. Für uns haben die Wölfe einen großen Einfluss auf die Landwirtschaft, auf die Almen“.
Claudio Groff, Koordinator des Bereichs Großraubtiere des Tierschutzdienstes der Autonomen Provinz Trient, war der nächste, der von der Kommission gehört wurde: „Hier begann die Überwachung, die hauptsächlich genetischer Natur ist, in den 1970er Jahren mit den letzten einheimischen Trentiner Bären. Auch bei der Radiotelemetrie sind wir ganz vorne mit dabei. Der Wolf wird über einen längeren Zeitraum überwacht: Im Jahr 2023 wird es schätzungsweise 98 Bären geben, alle Weibchen bleiben im westlichen Trentino, die Männchen ziehen über ein größeres Gebiet. Die Wölfe hingegen haben einen Bestand von etwa 25/30 Rudeln, die fast im gesamten Gebiet präsent sind. In Europa gibt es 23.000 Wölfe, die alle genetisch miteinander verwandt sind. Beide Arten sind geschützt und leisten einen positiven Beitrag zur Vielfalt der Alpen, führen aber auch zu Konflikten, die durch Vorbeugung und Entnahme begrenzt werden müssen. Die Zunahme der Bärenpopulation hat auch zu einem Anstieg der Schäden geführt, etwa 2,5 Schäden pro Tier. Jedes Wolfsrudel verursacht die doppelte Menge an Schäden. Vorbeugung ist unerlässlich, auf europäischer Ebene und bei uns: Herdenschutzhunde, Elektrozäune und das Halten von Hirten in der Nähe von Viehbeständen, Boxen, die als Unterschlupf in Höhenlagen dienen.“
Giovanni Giovannini, Direktor des Forstdienstes der Autonomen Provinz Trient, sprach über die Bewältigung von Notfällen, die durch große Raubtiere verursacht werden: „Die Notfälle wiederholen sich mit einer gewissen Häufigkeit. Unser Forstdienst hat 37 Stationen im Gebiet. In Bezug auf Bären und Wölfe wurde beschlossen, 14 Mitarbeiter zu spezialisieren, die zum so genannten Notfallteam gehören. Sie arbeiten Seite an Seite mit einer Hundestaffel, mit Hunden aus in Nordeuropa, und wir können innerhalb einer Stunde eingreifen: Wir können die Tiere abschrecken, aber auch den Menschen, die mit großen Raubtieren in Berührung kommen, die Situation erklären. Die Notfälle reichen von weiß über gelb bis rot. Im Jahr 2023 gab es neun Bärenangriffe und die Aufräumarbeiten sind heikel. Angriffe auf Menschen werden von einem Notfallteam und einem Team, das sich mit genetischen und anderen Untersuchungen befasst, behandelt. Wenn die Abschreckung nicht funktioniert, wird als letztes Mittel die Tötung beschlossen. Wölfe sind dem Menschen gegenüber sehr viel misstrauischer als Bären und bewegen sich hauptsächlich nachts. Dieses Raubtier zeigt auch kein repetitives Verhalten.“
Roland Norer (Ordinarius an der Universität Luzern) sprach über die rechtliche Situation beim Management von Großraubtieren. Er verfolge das Thema seit langem: „Die Probleme ergeben sich eher aus der Rechtsanwendung als aus der eigentlichen Rechtsprechung. Es gibt viel Literatur über Wölfe mit sehr unterschiedlichen Meinungen. Die Berner Konvention hat entschieden, welche Arten geschützt werden sollen, fast alle Raubtiere sind darunter. Der Schutz von Raubtieren ist nicht in allen europäischen Ländern gleich. Für Bären gelten in 9 Staaten Ausnahmeregelungen, Italien hat keine Vorbehalte angemeldet. Was kann getan werden? Es gibt Spielräume für Maßnahmen, zunächst für die Abschreckung und dann für die Entnahme, wobei die Voraussetzungen für eine Ausnahmeregelung gegeben sein müssen. Um eingreifen zu könne braucht es ein fachliches Gutachten und eine politische Entscheidung.“
Benedikt Terzer, Direktor des Südtiroler Jagdverbandes, erklärte: „Das Management von Großraubtieren bezieht sich hier auf Wölfe und Bären, und diese Arten sind hier sicher nicht gefährdet. Die Schutzmaßnahmen waren erfolgreich, aber jetzt müssen die Anhänge der FFH-Richtlinie geändert werden. Das geht aber nur mit der Einstimmigkeit der europäischen Staaten und das ist nicht einfach. In Slowenien gibt es 1200 Braunbären, und es wurde eine neue Strategie ausgearbeitet: die Reduzierung auf 800 Tiere. In Italien hingegen wurde noch kein einziger Wolf geschossen. In verschiedenen Teilen der Halbinsel wurden mehrere Wölfe illegal erlegt, was Italien nicht zur Ehre gereicht, und jetzt gibt es sogar Hybriden in unserem Land. In Schweden werden jedes Jahr Hunderte von Bären getötet, hier gibt es nach jeder Tötung Proteste.“
Luigi Boitani, emeritierter Professor für Zoologie an der Universität Rom „La Sapienza“ und Präsident der Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE), sprach über die Situation des Wolfes auf europäischer Ebene: „Der Wolf in Europa? Zu viele oder zu wenige, das ist keine sinnvolle Einschätzung. Sie nehmen leicht zu und sind nicht gefährdet. Ich möchte vermeiden, Wölfe und Bären in einen Topf zu werfen, wir brauchen ein unterschiedliches Management der beiden Arten. Südtirol und das Trentino allein können eine großflächige Population nicht managen. Was wir brauchen, ist ein Planungsansatz auf Populationsebene. Scheulose und problematische Tiere sind zwei verschiedene Dinge. Koexistenz ist möglich, aber das ist auch ein Kompromiss“.
Rok Cerne, Leiter der Projektgruppe Großraubtiere bei der slowenischen Forstverwaltung und Vorsitzender der WISO-Plattform, die sich im Rahmen der Alpenkonvention mit Großraubtieren befasst: „Ich werde mich auf die Bären in Slowenien konzentrieren, wo 60 Prozent des Territoriums bewaldet sind. Im Jahr 1998 gab es dort 40 Bären, jetzt sind es mehr als tausend. Wir haben auch Wölfe, jetzt sind es etwa 1.200. Die Tiere werden durch die Entnahme von DNA-Proben überwacht, und auch hier gibt es eine Debatte über die Zahl der Bären, aber wir haben eine lange Tradition der Bärenabschüsse. Die Maßnahmen werden von Jägern ergriffen, es gibt nur sehr wenige illegale Abschüsse, es gibt eine geregelte Quote. Die Keulung ist eine sehr schnelle Aktion, im Falle eines Angriffs auf Vieh wird der Bär sofort entfernt. Ja, es hat Angriffe auf Menschen gegeben, nur Körperkontakt, aber keine ernsthaften Angriffe in 15 Jahren. Auch in diesem Fall wird das Tier sofort entfernt. Wenn es ein Problem mit Bären und Wölfen gibt, verteidigen wir uns.
Zum Abschluss der Anhörungen in der Kommission sprach Andrea Vettori - Referatsleiter in der Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission - über das künftige Verfahren zur Herabstufung von Wölfen. Vettori wies auf die Komplexität des Themas hin: „Wir brauchen eine Kombination von Management und Information. Die Änderung der Berner Konvention zur Herabstufung wird im März beginnen, bis dahin haben sich die Regeln nicht geändert, wir brauchen Zeit, mindestens ein paar Monate. Ausnahmeregelungen fallen in die Zuständigkeit der Staaten, nicht der EU-Kommission. Jetzt ist es wichtig zu verstehen, dass sich die Verfahren geändert haben, und wir überlegen jetzt, wie wir sie praktikabel machen können. Das Ziel bleibt die Koexistenz“.
Nach diesen Ausführungen schloss Präsidentin Angeli die Sitzung.